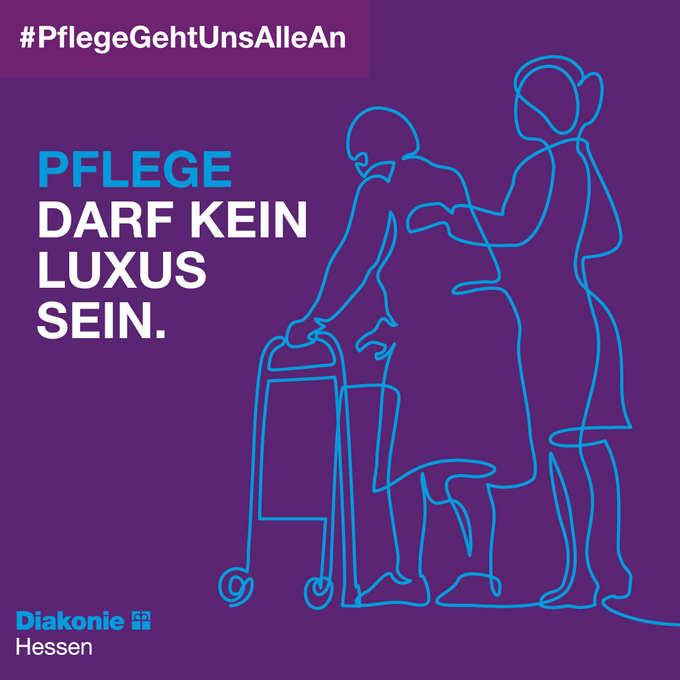Gesundheits- und Pflegeversorgung sichern
Pflege gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Nicht zu handeln hat demokratiegefährdende und volkswirtschaftliche Konsequenzen. Wir zeigen, worauf es nun ankommt.
22.12.2025
Was Sie auf dieser Seite finden
Pflege braucht mutige und verbindliche Reformen
Das Gesundheitssystem steht weiterhin unter enormem Druck. Die Pflege ist dabei der Bereich, der die größten Herausforderungen trägt. Steigender Pflegebedarf, massiver Fachkräftemangel und eine Finanzierungslücke von mehreren Milliarden Euro bringen das System an seine Grenzen. Trotz zahlreicher Warnungen und Reformansätze bleibt die Realität: Die Pflegeversorgung entspricht nicht den aktuellen Bedarfen und ist für viele Betroffene kaum noch bezahlbar.
Komplexe Strukturen und fehlende Vernetzung erschweren die Organisation von Pflegeleistungen. Während stationäre Einrichtungen und Krankenhäuser unter Kostendruck und Personalmangel leiden, wird die Hauptlast der Versorgung zunehmend in den häuslichen Bereich verlagert: Rund 85 % der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, oft ausschließlich durch Angehörige – mit gravierenden Folgen für deren Gesundheit und Erwerbsfähigkeit.
Pflege in der Diakonie Hessen
Die Diakonie Hessen unterstützt kranke und pflegebedürftige Menschen durch rund 500 Mitgliedseinrichtungen – darunter Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste und Hospizangebote.
Zum dritten Mal in Folge hat der Landesverband seine Pflegeeinrichtungen im Zeitraum von November 2024 bis April 2025 zur aktuellen wirtschaftlichen Lage befragt. Die Situationsanalyse, basierend auf einer Umfrage unter 110 von insgesamt rund 500 ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen, zeigt erneut: Die Lage in der Pflege ist kritisch.
Die Ergebnisse im Überblick:
- Wirtschaftliche Lage bleibt angespannt: Ein Viertel erwartet schlechtere Betriebsergebnisse.
- 63 Prozent der ambulanten Dienste mussten Anfragen ablehnen.
- Stationäre Einrichtungen erreichen im Schnitt 93 Prozent Auslastung, nötig wären 98 Prozent.
Situation in den Pflegeeinrichtungen der Diakonie Hessen
Stationäre Pflege
- Hohe Nachfrage, aber ungenutztes Potenzial: Durchschnittliche Auslastung liegt bei 93 %, dennoch bleiben Zimmer leer.
- Gründe: Personalmangel und kürzere Verweildauer, da viele erst in sehr schlechtem Gesundheitszustand aufgenommen werden.
Ambulante Pflege
- 63 % der Anfragen können nicht bedient werden – vor allem wegen fehlender personeller Kapazitäten.
- Späte Hilfe verschlechtert den Gesundheitszustand, erschwert Teilhabe und den Verbleib im eigenen Zuhause.
- Paradoxe Entwicklung: Viele nehmen weniger Leistungen in Anspruch, als sie benötigen, weil die Kosten zu hoch sind.
Pflegeberuf und Ausbildung
- 85 % der Einrichtungen bilden aus, darunter 80 % der ambulanten Dienste.
- Ausbildungszahlen stiegen um 10 % gegenüber 2024, aber 45 % der Plätze bleiben unbesetzt (fehlende Bewerbungen oder Eignung).
- Ziel: Weiter in gute Ausbildungsstrukturen investieren, um den Beruf attraktiv zu halten.
Zukunftspakt Pflege
- Positive Ansätze: Stärkung der häuslichen Pflege, flexible Budgets für ambulante Leistungen, Förderung von Digitalisierung und Innovation, neue Finanzierungsinstrumente.
- Kritik: Maßnahmen reichen nicht aus – grundlegende Reformen sind weiterhin dringend erforderlich.
Forderungen der Diakonie Hessen
+ + + Grundlegende Struktur- und Finanzreform der Pflegeversicherung + + +
+ + + Flexible, bedarfsgerechte und selbstbestimmte Versorgungsarrangements – orientiert an den Bedürfnissen der Menschen, nicht an starren Grenzen + + +
+ + + Mehr Vertrauen in pflegerische Kompetenz, weniger Bürokratie + + +
+ + + Klare Befugnisse und finanzielle sowie fachliche Unterstützung für Regionen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern + + +
Unsere Partner
Gemeinsam mit der Diakonie Deutschland und dem Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege e. V. (DEVAP e. V.) setzen wir uns auf Bundesebene für grundlegende Reformen ein. Auf Landesebene sind wir in den Ligen der freien Wohlfahrtspflege aktiv. Hier sind wir in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen vertreten und bringen die Interessen und Belange unserer Mitglieder der Diakonie Hessen ein.
Kontakt

Sonja Driebold
Leiterin Ressort Gesundheit, Alter, Pflege
sonja.driebold@diakonie-hessen.de 069 79476241 01512 9801162
Bettina Mügge
Referentin ambulante Pflege Ressort Gesundheit, Alter, Pflege
bettina.muegge@diakonie-hessen.de 069 79476242